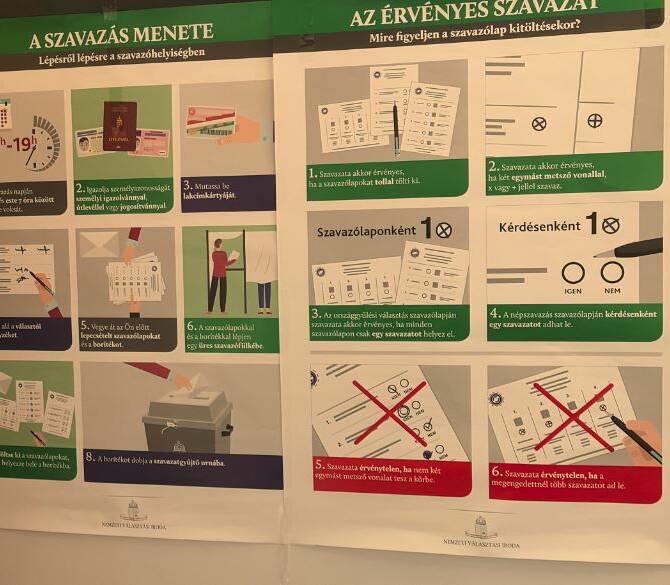Von Modeste Schwarz
Ungarn – Seit beinahe drei Jahrzehnten hat der sehr charismatische Ministerpräsident die nationale und internationale Öffentlichkeit an diese traditionelle Rede von Tusványos (nach dem Namen der jedes Jahr Ende Juli im Thermalbad Tusnádfürdő / Băile Tușnad im Szeklerland, dem ungarischen Sprachgebiet in der Mitte Rumäniens, organisierten Festspiele) gewöhnt, die er bewußt zu seiner wichtigsten programmatischen Rede des Jahres stilisiert. Es ist z.B. anläßlich einer dieser Reden, dass er feierlich den Begriff „Illiberalismus“ hervorbrachte, der inzwischen zu einem Topos des zeitgenössischen politischen Diskurses in Europa und darüber hinaus geworden ist.
Im Vergleich zu solchen markanten Reden ist die 2018er Rede wahrscheinlich nicht dazu berufen, tief im ungarischen und internationalen Gedächtnis geprägt zu bleiben, doch bleibt sie nichtsdestotrotz ein politischer Moment seltener Bedeutung.
Hiermit wollen wir also den Inhalt dieser Rede analysieren: unter dem Aspekt ihrer politischen internationalen Auswirkungen, unter dem der ungarischen Innenpolitik bzw. – da es sich um eine (obwohl nicht in offiziellem Rahmen) auf rumänischem Gebiet gehaltene Rede handelt – aus dem Standpunkt der ungarisch-rumänischen Beziehungen.
-
„Die christliche Demokratie kann per Definition nicht liberal sein“
Nach seiner Rede von einigen Teilnehmern über die Möglichkeit einer Trennung zwischen dem Fidesz und der Europäischen Volkspartei gefragt, stritt Viktor Orbán ab, diese zu wünschen und verbarg sich hinter dem symbolischen Argument der ungarischen Treue für geschlossene Bündnisse, seien sie gut oder schlecht. Doch der Höhepunkt – aus diesem Blickwinkel – der Rede selbst war deutlich dazu bestimmt, den westlichen Partnern des Fidesz verstehen zu lassen, dass diese Treue nicht unendlich bedingungslos sein könne. Seit seinem dritten Wahlsieg in Folge im vergangenen April wurde der starke Mann aus Budapest verdächtigt (und dadurch sogar angeregt), sich einigermaßen mäßigen zu wollen; so versuchten manche in Budapest wie in den westlichen Hauptstädten die Verdrängung des Wortes „illiberal“ in den Hintergrund zu interpretieren, dem die offizielle Fidesz-Kommunikation nunmehr systematisch die Bezeichnung „christlich-demokratisch“ bevorzugt. Gelinde gesagt hat die diesjährige Tusványoser Rede – während sie dieser neuen Kommunikationstaktik treu blieb – diese Illusionen zermalmt, indem sie in fünf Thesen ein Lehrgebäude vortrug, das den Inhalt der Bezeichnung „christlich-demokratisch“ präzisierte (1. Christliche Kultur ohne Multikulturalismus; 2. „jedes Kind hat ein Recht auf einen Vater und eine Mutter“; 3. wirtschaftliche Souveränität; 4. Grenzschutz; 5. „ein Staat-eine Stimme-Prinzip“ innerhalb der EU), behauptete Viktor Orbán erneut die ideologische Festigkeit des ungarischen dritten Wegs. Mit einer Andeutung, die die klugen Köpfe in Brüssel, Paris und Berlin nicht werden versäumt haben zu entziffern: der FIDESZ wird EVP-Mitglied bleiben (und, könnte man hinzufügen, auch wenn der Autor es abstreitet: Ungarn EU-Mitglied) mit der Bedingung, dass man seine Freiheit nicht einschränke, dieses Lehrgebäude anzuwenden. Die Hoffnung Viktor Orbáns – die er übrigens in eben dieser Rede deutlich zum Ausdruck brachte – ist selbstverständlich, dass diese Trennung aus dem Anlass der Europawahlen im kommenden Jahr vermieden werden kann, und zwar vielmehr durch die „Illiberalisierung“ der EVP als durch die Liberalisierung des Fidesz. Man muss, sagt er uns „die 68er Generation ablösen“: es ist in diesem vor allem politischen und kulturellen Zusammenhang, dass man einen weiteren markanten Spruch in dieser Rede interpretieren soll, als der ungarische Ministerpräsident die Brüsseler Eliten bezichtigt, die Errichtung eines neuen „europäischen Sozialismus“ einzufädeln. In ihrem Zusammenhang betrachtet – derjenige der symbolischen Erben des 1956er Aufstands –, stellt diese Erklärung weniger einen Rechtsruck des ungarischen dritten Wegs als ein souveränistisches Manifest dar (besagter Aufstand wurde nicht durch ein Murren von Arbeitgebern gegen Gewerkschaftsrechte und gegen das Arbeitsrecht, sondern durch die Ablehnung der „begrenzten Souveränität“ hervorgerufen, die damals gerade dabei war, nach den Jahren der harten bolschewistischen Diktatur der Periode 1948-1953 eingerichtet zu werden).
Die weiteren innenpolitischen Ausführungen, die diese Rede kennzeichneten, waren zwar genauso pointiert, doch hatten sie nicht so sehr den Reiz der Neuheit. Indem er die EU-Politik gegenüber Russland als „primitiv“ anprangerte, appellierte der ungarische Ministerpräsident darauf, diese durch eine „artikulierte“ sowohl realistische, vorsichtige wie ausgleichende Politik zu ersetzen. Während er weiterhin eine Integration des ukrainischen Failed State in die westlichen Strukturen als unwahrscheinlich und unerwünscht betrachtet, ließ er u.a. den Gedanken eines historischen Kompromisses zwischen NATO und Russland durchblicken, infolgedessen besondere Sicherheitsgarantien Polen und den baltischen Staaten gegen eine Erleichterung der Sanktionen gewährt würden, die einen Aufschwung des eurasischen Handels ermöglichen würden. Es obliegt der Zukunft, uns zu sagen, inwiefern diese im Übrigen durchaus vernünftige Herangehensweise auf die tatsächliche Hoffnung einer Lösung oder eher und vor allem auf den Willen basierte, es allen recht zu machen, indem man sowohl die ganz besondere Bedeutung der Washington-Budapest-Moskau-Achse in der Fidesz-Außenpolitik wie auch das ständige polnische Zögern in diesem Bereich berücksichtigte.
-
Offizielle Ankündigung des Anfangs des ungarischen Kulturkampfs.
Indem er freilich auch (vor den meisten ungarischen Fernsehsendern und einem mindestens zur Hälfte aus dem ungarischen Kernland stammenden Publikum) die wichtigsten Themen der ungarischen Innenpolitik erwähnte, positionierte sich der ungarische Ministerpräsident in ausgezeichneter Kontinuität zu seiner vor allem international gerichteten Stellungnahme ebenfalls in einer Debatte, die seit seinem Wahlsieg im April die Reihen des Fidesz und seiner Verbündeten in Unruhe versetzt: nach schon acht Jahren an der Macht, die – nicht ohne einige durchaus lobenswerten Resultate – dazu gewidmet wurden, die öffentlichen und privaten Finanzen, die Wirtschaft und die Demographie Ungarns wieder auf die Beine zu stellen, nach den diplomatischen Erfolgen der Jahre 2015-2018, fordern viele unter den Fidesz-Hardlinern, dass man nunmehr eine echte kulturelle Politik führe. Der Journalist Árpád Szakács und der Schriftsteller János Dénes Orbán und andere haben sich zu Wort gemeldet, um bemerken zu lassen, dass ein Großteil der Intellektuellen und Künstler, die (im allgemeinen aus dem Hut gezogene) alarmistische Erklärungen über die „Orbán-Diktatur“ von sich gaben, großzügig von der heutigen Regierung (wie von den früheren) subventioniert werden und sich trotz ihrer regelmäßigen Kundmachung einer bevorstehenden Abreise ins Exil unweigerlich auf ihren Budapester Druckposten zusammengerollt bleiben und mehr als gemütlich von den Staatsgeldern leben, die ein Regime ihnen zahlt, das – würde man ihnen Glauben schenken (und die westliche Presse macht sich eine heilige Aufgabe, es zu tun) – dabei sei, „die Meinungsfreiheit zu unterdrücken“. Schlimmer noch: indem sie wie eine echte Kaste die kulturellen und akademischen Institutionen weiterhin beherrschen, neigen diese „subventionierten Refuzniks“ dazu, ihre Kollegen daraus auszuschließen, die „nicht ordentlich denken“ (und besonders… diejenigen, die den Fidesz unterstützen!). Von der ungarischen und internationalen liberalen Presse als ein „Säuberungsversuch“ scharf kritisiert ist dieser Aufruf zum „Kulturkampf“ jedoch in Wirklichkeit ein Appel für die Achtung der kulturellen Vielfalt – bzw. auch der demokratischen Werte, insofern die große Mehrheit der Ungarn, die sich zur Fidesz-Politik bekennen, sich wahrscheinlich nicht durch eine liberale/postmodernistische kulturelle Elite vertreten fühlt, die obwohl sie von ihren Steuergeldern lebt, es selten versäumt, sie zu beschimpfen.
An diesem 28. Juli nahm Viktor Orbán also vorsichtig doch standhaft zugunsten des Kulturkampfs Stellung, indem er diesem übrigens eine philosophisch-kulturelle Dimension gab, die über die Kleinlichkeit der Debatten über die Zuweisung von Subventionen hinausgeht. Indem er seinen gefesselten Zuhörern eine Art vereinfachte Einleitung in die „Metapolitik“ verschaffte (das Wort selbst wurde nicht ausgesprochen, doch die Absicht war dabei), erklärte er, die Weichen für eine „neue Ära“ der ungarischen Gesellschaft setzen zu wollen; doch das, was, sagt er uns, eine Ära über die bloße institutionelle Dimension definiert, ist ihre Lebensweise, ihre Sensibilität, ihr Geschmack. Man sieht, inwieweit die Doktrin des ungarischen Regimes sich von den Reagonomics vom Anfang des Fidesz entfernt hat, von einer Zeit, wo (in einer übrigens etwa absurden Weise in einem Land, wo wie in Frankreich die Kultur immer Sache des Staates gewesen ist) er sich vor dem liberalen Dogma beugte, das vorschreibt, dass die Kultur eine Ansammlung von privaten Aktivitäten wäre, die den Staat keinesfalls etwas angehen. Sogar auf institutioneller Ebene ist das Erbe aus dieser Zeit sichtbar, u.a. dadurch, dass es heute in Ungarn kein Kulturministerium gibt (obwohl der dafür zuständige Staatssekretariat einigermaßen ministeriumsähnliche Befugnisse besitzt).
Selbstverständlich ist es zu früh um zu sagen, wie dieser Kulturkampf konkret aussehen wird, wenn die Absicht sich – wenn überhaupt – in die Tat umsetzen wird. Trotzdem kann man – von Rede zu Rede – die Kohärenz der Orbán’schen Doktrin nur feststellen: genau vor einem Jahr in der Tat hatte der gleiche Viktor Orbán (in einer damals noch von der Migrantenfrage dominierten Rede) bemerken lassen, dass die sehr ambitionierte Familienpolitik, die er schon seit mehreren Jahren eingerichtet hatte, an die unsichtbaren Grenzen der kulturellen Gewohnheiten stöße – u.a. wegen der malthusianischen Gewohnheiten, die viele ungarischen Frauen charakterisieren. Ohne dass das Tabuwort „Feminismus“ je ausgesprochen wurde, ist es nach wie vor klar, dass der erste Mann in Ungarn sich (und ich würde fast sagen: endlich) der sozialpolitischen Konsequenzen des liberalen Individualismus und der Unmöglichkeit bewußt wurde, sie im Sinne eines bloßen bürgerlichen Juridismus (sprich einzig und allein durch eine gesetzliche Einschränkung der Abtreibungsregelungen usw.) zu bekämpfen. Es ist in diesem Zusammenhang, dass der Aufruf, „die 68er Generation abzulösen“ einen tiefen strategischen Sinn erhält, der über die vorhandenen taktischen Feindschaften zwischen Budapest und irgendeinem westlichen liberal-libertären Anführer à la Macron oder Juncker hinausgeht: langfristig (was Viktor Orbán selber in seiner Rede um die Jahre 2030 festsetzte) werden die ungarische nationale Revolution von 2010 und der seitdem vom Fidesz errichtete „System der nationalen Zusammenarbeit“ nur gesiegt haben, wenn sie es schaffen, das kulturelle Paradigma effektiv zu verändern – was derzeit nicht der Fall ist.
-
Siebenbürger Widersprüche
Schließlich, verwurzelt in einem durchaus komplizierten Zusammenhang, den sogar die meisten ungarischen Kommentatoren nur ungenau beherrschen, wird die Siebenbürger Dimension der Tusványoser Rede wahrscheinlich der Aspekt des Ereignisses sein, der vom Medienecho am meisten vernachlässigt bzw. verzerrt wird – und dies auch, weil die seltenen (vorwiegend ungarischen und rumänischen) Analysten, die das Thema beherrschen, nicht unbedingt Interesse daran haben, den Finger auf die Wunde zu legen.
Denn in der Tat vor der Rede des ungarischen Ministerpräsidenten sprach, gemäß der Tradition, der siebenbürgisch-ungarische Bischof und Politiker László Tőkés, eine Vordergrundfigur der Ereignisse von Dezember 1989 und Gastgeber Viktor Orbáns in seiner Eigenschaft als charismatische Figur des ungarischen Nationalismus in Siebenbürgen. Trotz geringer Zugeständnisse blieb diese Einleitungsrede den antikommunistischen und irredentistischen Topoi äußerst treu, die seit dem Anfang nicht nur den Diskurs des Politikers László Tőkés sondern auch die „Widerstands-“ und Opferideologie eines Großteils der ungarischen Eliten in Siebenbürgen kennzeichnen. Da der Diskurs und die diplomatische Positionierung Viktor Orbáns Bukarest gegenüber sich im Laufe der letzten Jahre (und besonders im Laufe des letzten Jahres) wesentlich entwickelt haben, wurde volens nolens die Aneinanderreihung dieser beiden Register für den einigermaßen aufmerksamen Beobachter zu einem Dialog der Vergangenheit mit der Zukunft. Während er die V4 kaum erwähnte, blieb der Bischof seiner Rolle als „Menschenrechtsaktivist“ treu und gewährte auf rumänischer Seite seine Wertschätzung nur einer winzigen Elite liberaler Figuren des Protests der Jahre 1980 und 1990 (die inzwischen großteils von den Regimen Băsescus und Johannis’ vereinnahmt wurden), und schaffte es sogar zu bedauern, dass die „spontane“ Teilnahme Traian Băsescus (der inzwischen zu einem harten ungarischfeindlichen Diskurs zurückgekommen ist) am Festival ein Ende gefunden habe! Was den Verrat Klaus Johannis’ anbelangt (der ihm persönlich seine rumänischen Dekorationen zurückgenommen hat, mit der Hoffnung, erneut Spannungen unter den Völkern Siebenbürgens zu schüren und die PSD-RMDSZ-Achse zu sabotieren), statt darin, die logische Konsequenz der Abhängigkeit zu sehen, in der sich die „rumänische Rechte“ dem vom Westen kontrollierten Schattenstaat gegenüber befindet, bevorzugte er, das auf das Konto einer Art Psychose der Assimilation bei diesem Siebenbürger Sachsen zu schreiben, der, obwohl er sehr schlecht Rumänisch spricht, keine Gelegenheit versäumt, zu erklären, dass er „Rumäne mit dem Herzen“ sei.
Indem er anscheinend seinem Gastgeber Recht gab, übernahm Viktor Orbán trotzdem dessen Themen in einer stark komprimierten bzw. derart veränderten Weise, dass es einem schwer fiel, den Eindruck eines widersprechenden Plädoyers nicht zu haben. Im Zusammenhang mit den derzeit stattfindenden Feiern des hundertsten Jahrestags Großrumäniens begnügte er sich darin, daran zu erinnern – indem er seine Stimme dem elementarsten Hausverstand verlieh – dass die Rumänen wohl nicht erwarten konnten, dass die Ungarn sich (unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft) über die Erwähnung der Erinnerung an den Vertrag von Trianon freuen würden, und sprach den Wunsch aus (ohne Namen zu nennen), dass die rumänische Justiz keine Unschuldigen verurteile (vor Ort dachte dann jeder ganz stark an die beiden vor kurzem eingekerkerten Szekler Aktivisten – doch konnte die Rede genauso auf andere ungarische Opfer der „Anti-Korruptions-Kreuzzüge“ der Kövesi-Ära anspielen. Wie erwartet durch die rumänische atlantistische Presse (wie Hotnews, ein altes Propagandaorgan des ehemaligen Băsescu-Regimes) sofort herausgestellt, stellten diese Worten in Wirklichkeit eher einen impliziten Aufruf zur Ruhe nach den rhetorischen Ausschweifungen László Tőkés’ dar.
Schließlich und besonders, während der 66jährige kalvinistische Bischof fast ausschließlich über eine schmerzhafte Vergangenheit sprach, ohne wirklich Zukunftsperspektiven anzubieten, widmete der elf Jahre jüngere Viktor Orbán seine meiste Redezeit (was regionale Themen betrifft) der Visegrád-Gruppe, die allein in der Lage ist, die Wunden besagter Vergangenheit zu heilen: regionale Integration (durch Energie und Verkehrsverbindungen) und Diplomatie „von Staat zu Staat“ (die stillschweigend die siebenbürgischen Eliten kurzschließt, die sich oft in der moralischen Bequemlichkeit wähnen, die der Status als unterdrückte Minderheit in der Zeit des florierenden Globalismus anbot).
Da er wahrscheinlich den potentialen Konflikt vorahnte, der durch diese sowohl ideologische wie generationsbezogene Meinungsverschiedenheit verursacht wurde, entschied sich schließlich der feine Taktiker Viktor Orbán dafür, sich aus der Sache durch einen Scherz herauszuziehen, indem er seine Vertrauensbeziehung mit Liviu Dragnea mit einem quasi-offiziellen Flirt verglich, den man geheimhalten müsse, um die Ressentiments der Eltern und Freunde nicht zu schüren. Obwohl stillschweigend stimmte übrigens der Vergleich: während das Lager der Vergangenheit weiter in den Irredentismus geht, was von Natur aus idealistisch schwerlich mehr als eine paralysierende und sterilisierende Nostalgie sein kann, will das Lager der Zukunft nach vorne gehen und weiß, dass es schwierig sein wird, ein stabiles und blühendes Mitteleuropa zu bauen, ohne dass die Beziehung zwischen Bukarest und Budapest gut funktioniere.
Die diesjährige Tusványoser Rede wurde also zur Gelegenheit, einer echten Vorstellung von Ausweichmanövern und unwahrscheinlichen Toren jenes Ronaldinho der Politik namens Viktor Orbán beizuwohnen. Hundert Jahre nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns, mitten in Rumänien, kündigt er an (es ist der Titel, den sein eigener Pressedienst gewählt hat), dass „die hundert Jahre der ungarischen Isolierung zu Ende sind“, und schafft es gleichzeitig im ziemlich irrendentistischen Ton der Festspiele zu bleiben, während er eine Politik der gereichten Hand in Richtung Bukarest treibt. Während seine eigene politische Familie und die Weichen in seiner Bewegung ihn dazu aufrufen, die Reihen zu schließen, kündigt er schlicht die Pensionierung der 68er Eurokratie an. Von einer ungarischen Enklave irgendwo zwischen Polen und Rumänien macht er eine ungarische Kreuzung, wo jeder seine Identität behalten kann, doch wo alle durchmüssen, um an den neuen Flüssen der Energie, des Transports aber auch der Ideen und der Kultur nicht vorbeizugehen. Seit langem als ein politischer Führer anerkannt, dessen Format mit dem der ungarischen nationalen Größen Széchenyi, Kossuth oder Bethlen vergleichbar ist, erhebt sich der kleine Provinzler aus Felcsút langsam aber sicher – wider Erwarten in demokratischem Rahmen – zu diesen mythischen Höhen des Widerstands der Kuruzen, wo die riesigen Schatten der Fürsten Rákóczi wandeln.
Aus dem Französischen übersetzt von Visegrád Post.